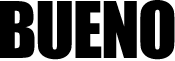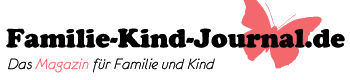Abwanderung aus der Zukunft: Die Wirtschaftskrise führt in Südeuropa zur Nachwuchsmisere
19 Mai
Wie tief die Krise in Europa wirklich ist, zeigt nüchtern die Statistik der Europäischen Kommission. Sie weckt ernsthafte Zweifel an der Fortschrittsrhetorik ihrer Funktionäre und Politiker. Ganz offenkundig gilt das für die Wirtschaft in Griechenland, die sich auch dieses Jahr nicht nach den EU-Wachstumsprognosen richtet, sondern schon wieder schrumpft. Die Arbeitslosigkeit verharrt auf einem Niveau, das an die Zeit der Weltwirtschaftskrise erinnert. Nicht viel besser sieht es in Spanien und Italien aus, trotz der tatsächlichen oder auch angeblichen „Reformfortschritte“.
Leidtragende der Krise sind besonders die Jugendlichen, denen es an Arbeits- und Zukunftsperspektiven fehlt. Ihre Arbeitslosenquoten verharren in Spanien und Griechenland bei über 50%, bei weit über 40% in Kroatien und Italien (1). Diese Quoten bedeuten nun nicht, dass dort jeder zweite Jugendliche „auf der Straße“ steht, wie Medien verbreiten. Denn Arbeitslosenquoten beziehen sich immer auf Erwerbspersonen, also diejenigen, die berufstätig sind oder Arbeit suchen. Dazu gehören diejenigen Jugendlichen aber nicht, die noch Schulen oder Hochschulen besuchen (2). Genau genommen bedeutet eine Jugendarbeitslosigkeit von 50% also, dass jeder zweite Jugendliche, der Arbeit sucht, keine findet. Viele junge Südeuropäer suchen deshalb anderswo, z. B. in Deutschland, nach Arbeit. Diese jungen Arbeitskräfte, die oft mit hohem Aufwand akademisch ausgebildet wurden, fehlen dann in ihrer Heimat, was die Krise in Südeuropa weiter verschärft (3). Langfristig noch bedrohlicher als dieser „brain drain“ ist eine andere Art der Abwanderung – die aus der Zukunft. Nichts anderes ist, gesellschaftlich gesehen, der Verzicht auf Kinder. Der zeigt sich in der Geburtenstatistik: Zwischen 2008 und 2013 sind die absoluten Geburtenzahlen in Portugal und Griechenland um etwa 10% und in Spanien sogar um 20% zurückgegangen (4). Folglich sind die Geburtenraten deutlich gesunken; in Portugal haben sie mit 1,21 Kindern in 2013 einen neuen Negativrekord erreicht (5).
Auch das widerlegt optimistische Prognosen: Noch bis vor kurzem prophezeiten namhafte Sozialforscher ein „Comeback der Babys“. Anlass dazu gab die Geburtenentwicklung zwischen 2000 und 2008. In Mittelost- und Südeuropa waren die Geburtenraten von den extrem niedrigen Werten Ende der 1990er Jahre wieder deutlich angestiegen. Man erwartete, dass sich dieser Trend fortsetzen und auch Länder wie Deutschland erfassen würde, in denen die Geburtenraten stagnierten. Ihre Anstiegsprognosen begründeten sie damit, dass der jahrzehntelange Trend zum Aufschub von Geburten in ein immer höheres Lebensalter zu einem Ende kommen, oder sich zumindest wesentlich verlangsamen würde (6). Aber genau das ist nicht passiert: In der letzten Dekade ist das Alter, in dem Frauen ihr erstes Kind bekommen, weiter angestiegen, insbesondere in Südeuropa. Traditionell bleiben dort die jungen Menschen solange im Elternhaus leben, bis sie heiraten und eine Familie gründen. Dafür aber fehlt es an Arbeit, Einkommen und eigener Wohnung. So bleiben viele lange, oft bis in das vierte Lebensjahrzehnt, von den Eltern abhängig – „Hotel Mama“ wird zur Dauernotunterkunft. Je später Frauen aber ihr erstes Kind bekommen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass mehrere weitere Kinder folgen. Und so kommt es, dass ausgerechnet in den einst für Kinderreichtum bekannten Ländern Südeuropas heute dritte und weitere Geburten besonders selten sind. Erschwerend kommt hinzu, dass es in Südeuropa wenig finanzielle Hilfen für Familien gibt. In Frankreich, aber auch in Nordeuropa, ist die Familienförderung deutlich großzügiger bemessen. Nicht zufällig sind dort kinderreiche Familien häufiger und die Geburtenraten höher (7). Aber auch dort bremst die Wirtschaftskrise die Geburtenneigung: Insbesondere in Dänemark, das vielen als „Best-Practice-Modell“ öffentlicher Kinderbetreuung gilt, ist die Geburtenrate deutlich zurückgegangen. In Deutschland stagniert sie (8). Europa verbleibt im Krisenmodus, nicht nur ökonomisch, sondern mehr noch demografisch und sozial.
(1) Vgl.: Eurostat: Harmonisierte Arbeitslosenquote nach Geschlecht – Alter 15-24, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=teilm021&plugin=1.
(2) Eingehender hierzu: Nachricht der Woche, 2013 / 27-29, 18.07.2013, http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2013/07/18/artikel/denkfehler-in-bruessel-warum-es-weniger-arbeitslose-jugendliche-gibt-als-immer-behauptet-wird.html.
(3) Hierzu: Nachricht der Woche, 2015 / 2, 19.01.2015, http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2015/01/19/artikel/einwanderung-multikulti-lohnt-sich-nur-fuer-die-arbeitgeber.html.
(4) Eigene Berechnungen. Zu den Zahlen: Geburteneinbruch in Eurokrisenländern (Abbildung)
(5) Vgl.: Geburtenrückgang in Europa seit der Finanzkrise (Abbildung).
(6) Eingehender hierzu: Nachricht der Woche, 2014 / 14, 24.07.2014, http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2014/07/24/artikel/wenn-forscher-sich-irren-das-platzen-der-baby-blase-und-der-wunderglaube-an-die-ganztagsbetreuung.html.
(7) Vgl.: Eurostat: Pressemitteilung 85/2015 zum Internationalen Tag der Familie vom 13. Mai 2015 Anteil der Lebendgeburten nach Geburtenfolge in den EU-Mitgliedstaaten (2013).
(8) Vgl.: Geburtenrückgang in Europa seit der Finanzkrise (Abbildung).
Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:
Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie e.V
Neckarstr. 13
53757 Sankt Augustin
Telefon: +49 (2241) 332717
Telefax: nicht vorhanden
http://www.i-daf.org
Ansprechpartner:
Jürgen Liminski
Dateianlagen:
Weiterführende Links
- Originalmeldung von Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie e.V
- Alle Meldungen von Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie e.V